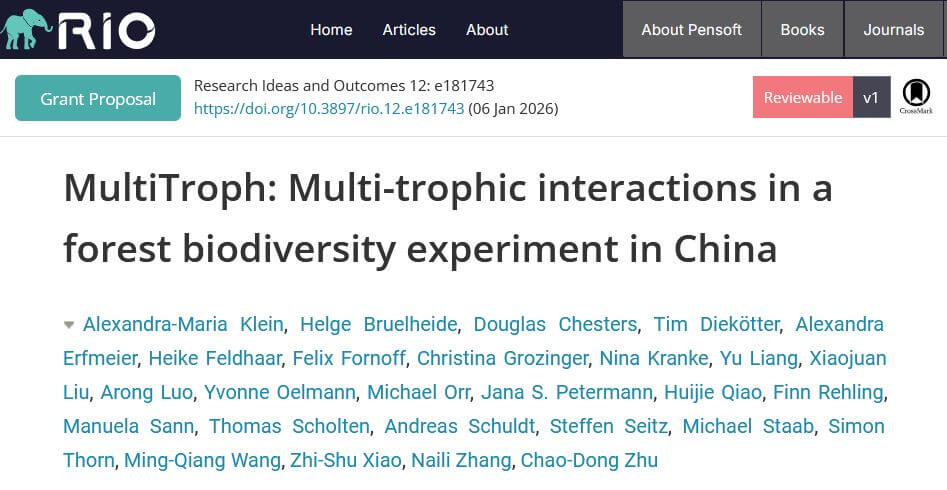
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Alexandra-Maria Klein, Helge Bruelheide, Douglas Chesters, Tim Diekötter, Alexandra Erfmeier, Heike Feldhaar, Felix Fornoff, Christina Grozinger, Nina Kranke, Yu Liang, Xiaojuan Liu, Arong Luo, Yvonne Oelmann, Michael Orr, Jana S. Petermann, Huijie Qiao, Finn Rehling, Manuela Sann, Thomas Scholten, Andreas Schuldt, Steffen Seitz, Michael Staab, Simon Thorn, Ming-Qiang Wang, Zhi-Shu Xiao, Naili Zhang, Chao-Dong Zhu
Zusammenfassung: Die traditionelle Forschung zur Beziehung zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen (BEF) hat gezeigt, dass artenreiche Pflanzengemeinschaften die Produktivität, die Kohlenstoffbindung und die Stabilität von Ökosystemen erhöhen. Die Rolle höherer trophischer Ebenen bei diesen Effekten ist jedoch bislang nur unzureichend erforscht. Um diese Wissenslücke zu schließen, nutzt MultiTroph die experimentelle Plattform BEF-China, das weltweit größte Experiment zur Waldbiodiversität, um Arteninteraktionen über verschiedene trophische Ebenen hinweg zu quantifizieren und in Nahrungsnetze zu integrieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Analyse trophischer Interaktionsnetzwerke Aufschluss darüber geben wird, wie sich ökologische Nischen in artenreichen und artenarmen Wäldern überschneiden, und dazu beitragen wird, zu erklären, wann und warum sich Ökosystemfunktionen mit dem Verlust von Arten verändern oder destabilisieren.
Schlussfolgerung: Der Artikel skizziert den konzeptionellen Rahmen und die Forschungsziele von MultiTroph und präsentiert einen ganzheitlichen Ansatz für die BEF-Forschung, indem er explizit höhere trophische Ebenen und deren Wechselwirkungen einbezieht.
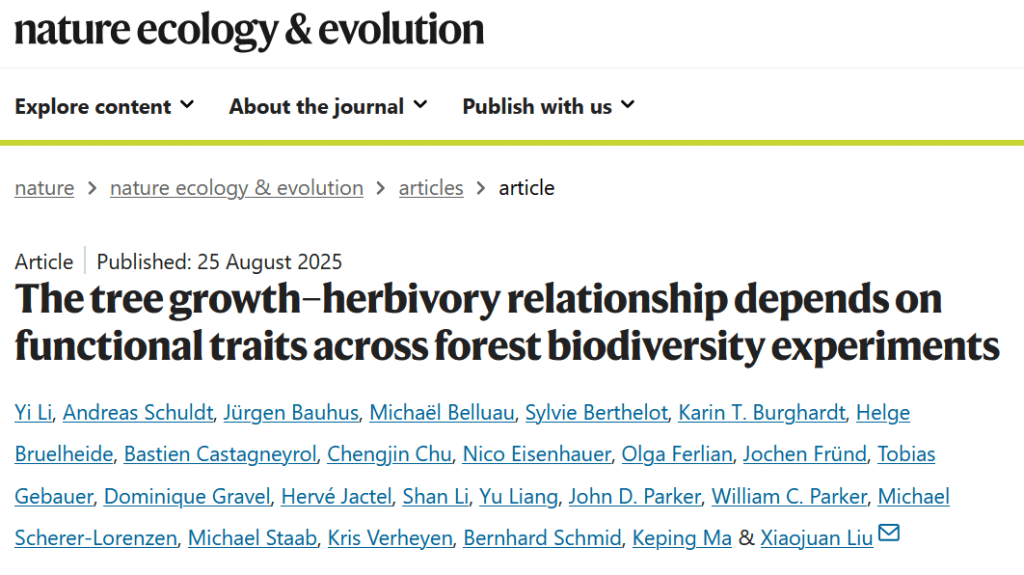
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Yi Li, Andreas Schuldt, Helge Bruelheide, Shan Li, Michael Staab, Xiaojuan Liu
Zusammenfassung: Diese Studie zeigt, dass eine größere Artenvielfalt und ein stärkeres Wachstum der Bäume in der Regel zu einer erhöhten Insektenfraßrate in Wäldern führen, wobei diese Auswirkungen bei Bäumen mit einem hohen Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis in den Blättern und zäheren Blättern am stärksten sind und zusätzlich durch Klima- und Bodenbedingungen beeinflusst werden. Die Ergebnisse zeigen erhebliche Unterschiede zwischen den Standorten und unterstreichen, dass funktionelle Merkmale, insbesondere die Blattchemie, eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Beziehungen zwischen Wachstum und Insektenfraß in gemäßigten und subtropischen Wäldern spielen.
Schlussfolgerung: Wälder mit einer größeren Baumvielfalt und einem stärkeren Wachstum sind anfälliger für Insektenfraß, insbesondere wenn funktionelle Merkmale die Ernährung von Pflanzenfressern begünstigen. Dies unterstreicht die Bedeutung von merkmalsbasierten Ansätzen im Ökosystemmanagement.

Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Ming-Qiang Wang, Georg Albert, Douglas Chesters, Helge Bruelheide, Yi Li, Jing-Ting Chen, Shan Li, Tobias Proß, Bo Yang, Qing-Song Zhou, Xiaojuan Liu, Chao-Dong Zhu, Arong Luo, Andreas Schuldt
Zusammenfassung: Diese Studie untersucht, wie die Artenvielfalt der Bäume, die Wachstumsdynamik der Bäume und die mikroklimatischen Bedingungen unabhängig voneinander und in Wechselwirkung die Stabilität der Lepidoptera-Herbivoren-Gemeinschaften in subtropischen chinesischen Wäldern beeinflussen. Anhand von Daten aus sechs Jahren und drei Jahreszeiten pro Jahr bewertet die Studie die Auswirkungen der Artenvielfalt der Wirtsbäume, der funktionellen Vielfalt, der Wachstumsraten und des lokalen Klimas auf die Häufigkeit, Vielfalt und räumlich-zeitliche Stabilität der Raupen-Gemeinschaften.
Schlussfolgerung: Die Autorinnen und Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Baumvielfalt eine entscheidende Rolle dabei spielt, Pflanzenfressergemeinschaften gegen Klimaschwankungen zu schützen und so ihre räumlich-zeitliche Stabilität zu fördern. Diese Erkenntnis unterstreicht das Potenzial des Verlusts der biologischen Vielfalt, die Schwankungen der Pflanzenfresserpopulationen zu verstärken und das Risiko von Schädlingsbefall zu erhöhen.
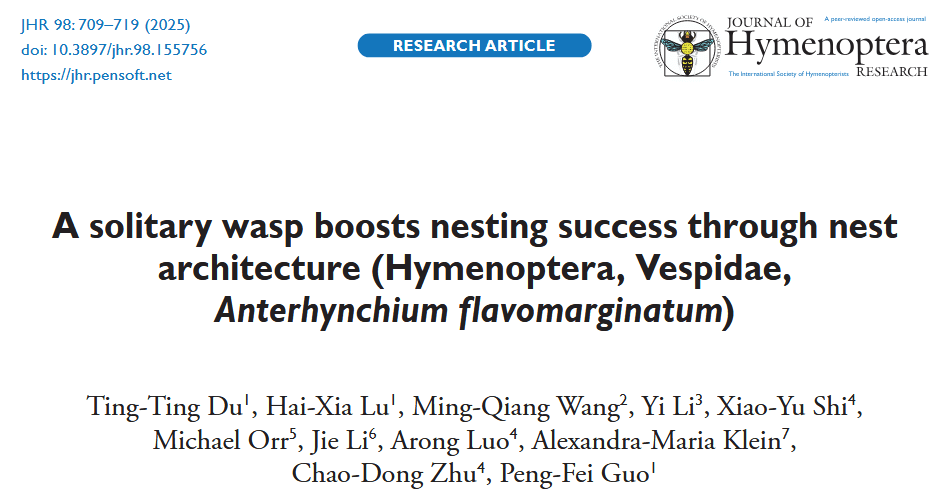
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Ming-Qiang Wang, Yi Li, Michael Orr, Arong Luo, Alexandra-Maria Klein, Chao-Dong Zhu
Zusammenfassung: Diese Studie untersuchte, wie die Nestarchitektur den Bruterfolg der solitären Wespe Anterhynchium flavomarginatum in einem subtropischen Wald im Südwesten Chinas beeinflusst. Unter Verwendung standardisierter Fallennester analysierten die Forscher die Auswirkungen von drei strukturellen Faktoren: Zwischenzellen, Nestdurchmesser und Vestibüllänge. Die Ergebnisse zeigten, dass der Bruterfolg mit der Anzahl der Zwischenzellen signifikant zunahm, was darauf hindeutet, dass diese den sich entwickelnden Larven Schutz und räumliche Stabilität bieten. Auch der Nestdurchmesser spielte eine Rolle: Die Wespen erzielten den höchsten Erfolg in Nestern mit einer Breite von 6–8 mm, während Nester mit einer Breite von 14–16 mm deutlich schlechter abschnitten. Die Länge des Vorraums hatte ebenfalls Einfluss auf die Ergebnisse: Nester ohne Vorraum hatten einen deutlich geringeren Erfolg als solche mit Vorräumen von 1–90 mm Länge. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, wie die Nestarchitektur den Fortpflanzungserfolg und das Überleben von Solitärwespen beeinflusst.
Schlussfolgerung: Die Studie trägt nicht nur zum Verständnis der Nestbauweise solitärer Wespen bei, sondern liefert auch praktische Hinweise für den Naturschutz und die biologische Schädlingsbekämpfung. Durch die Entwicklung von Trap-Nestern mit optimalen strukturellen Eigenschaften könnte es möglich sein, das Bevölkerungswachstum dieser Wespen zu fördern und ihre Wirksamkeit als natürliche Regulatoren von Schmetterlingsschädlingen in landwirtschaftlichen Ökosystemen zu verbessern.
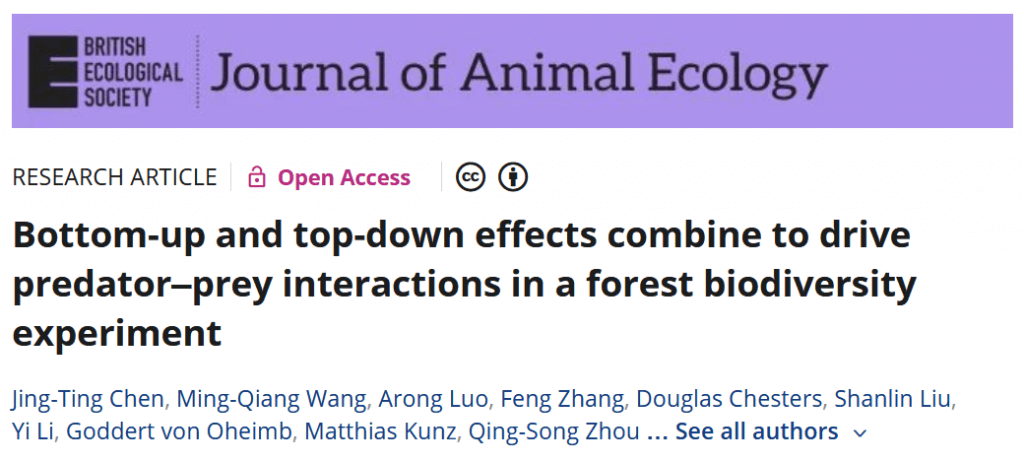
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Jing-Ting Chen, Ming-Qiang Wang, Arong Luo, Douglas Chesters, Yi Li, Qing-Song Zhou, Helge Bruelheide, Xiao-Juan Liu, Andreas Schuld, Chao-Dong Zhu
Zusammenfassung: In dieser Studie wurde die Metabarcoding-Analyse von Spinnenmageninhalten im Rahmen eines groß angelegten Biodiversitätsexperiments in einem subtropischen Wald eingesetzt, um zu untersuchen, wie Baumvielfalt (Bottom-up-Effekte) und Spinnenvielfalt (Top-down-Effekte) gemeinsam die Beutevielfalt sowie die Struktur von Räuber–Beute-Netzwerken beeinflussen. Die Ergebnisse zeigten, dass eine höhere funktionelle Diversität der Bäume sowohl den Artenreichtum der Beute als auch den Beutetausch unter allen Spinnenarten erhöhte. Die maßgeblichen Einflussfaktoren variierten jedoch zwischen den Jagdstrategien: Während bei netzbauenden Spinnen die phylogenetische Diversität der Bäume die Beutenutzung bestimmte, wurde bei jagenden Spinnen die Interaktionsstruktur maßgeblich durch die vertikale Komplexität der Baumarchitektur geprägt. Diese Befunde unterstreichen die kombinierte und kontextabhängige Wirkung von Bottom-up- und Top-down-Prozessen auf multitrophische Netzwerke.
Schlussfolgerung: Insgesamt beeinflussen sowohl die Vielfalt der Baum- als auch der Spinnengemeinschaften die Räuber–Beute-Interaktionen maßgeblich, wobei ihre relative Bedeutung vom Jagdmodus der Räuber abhängt. Die Integration funktioneller Merkmale, phylogenetischer Beziehungen und struktureller Habitatvielfalt erweist sich als zentral, um Zusammenhänge zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen zu verstehen und fundiert vorhersagen zu können.
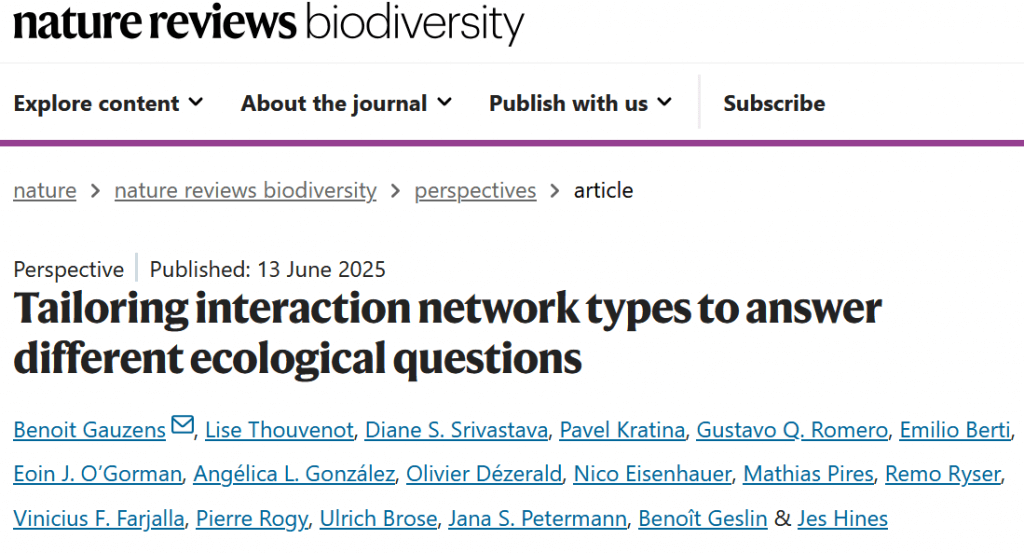
Mitwirkendes Mitglied von MultiTroph: Jana Petermann
Zusammenfassung: Dieser Artikel beleuchtet, wie ökologische Interaktionsnetzwerke gezielt gestaltet werden können, um unterschiedliche ökologische Fragestellungen zu adressieren. Dabei werden zwei zentrale Unterscheidungsmerkmale hervorgehoben: der Grad der Aggregation der Knoten und die Art der in den Verbindungen enthaltenen Informationen. Netzwerke mit zu funktionellen Gruppen zusammengefassten Knoten eignen sich besonders zur Untersuchung von Prozessen auf Ökosystemebene, während Netzwerke auf Artniveau Einblicke in die Gemeinschaftszusammensetzung sowie in den Einfluss von Umweltfaktoren auf das Fortbestehen einzelner Arten ermöglichen. Zudem wird zwischen Netzwerken mit potenziellen Verbindungen – geeignet für Langzeit- und großräumige Studien – und solchen mit realisierten Interaktionen unterschieden, die einen detaillierteren Zugang zu den zugrunde liegenden Mechanismen bieten.
Schlussfolgerung: Ein Verständnis der jeweiligen Stärken und Grenzen unterschiedlicher Interaktionsnetzwerke unterstützt die methodische Entscheidungsfindung und erhöht den Nutzen ökologischer Netzwerke in der Biodiversitäts- und Naturschutzforschung. Diese Orientierungshilfe kann Forschenden dabei helfen, den für ihre spezifischen ökologischen Fragestellungen geeigneten Netzwerktyp auszuwählen.
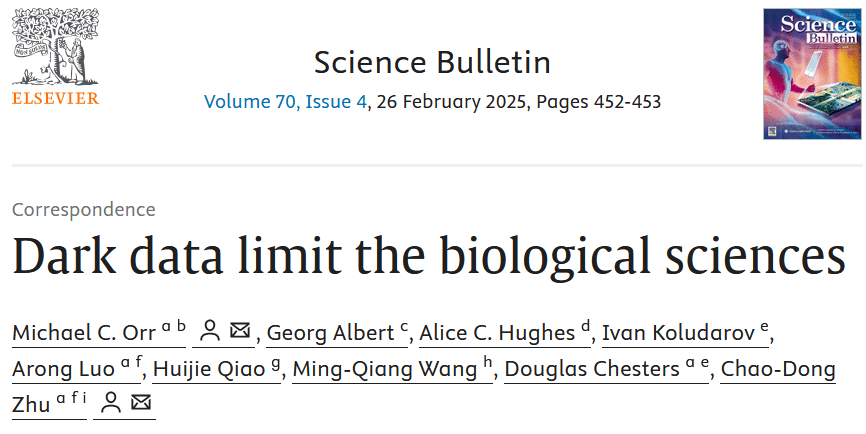
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Michael C. Orr, Georg Albert, Arong Luo, Huijie Qiao, Ming-Qiang Wang, Douglas Chesters, Chao-Dong Zhu
Zusammenfassung: Der Artikel behandelt die Herausforderung sogenannter „dunkler Daten“, also wissenschaftlicher Daten, die zwar technisch verfügbar, aber praktisch nicht zugänglich sind – etwa aufgrund fehlender Metadaten, mangelnder Standardisierung oder verschwindender Datenbanken. Die Autorinnen und Autoren argumentieren, dass trotz der zunehmenden Verbreitung von Open-Science-Richtlinien inkonsistente Praktiken beim Datenaustausch großräumige biologische Forschung und die langfristige Nutzbarkeit von Daten behindern. Sie schlagen vor, standardisierte, zukunftssichere Datenformate, verpflichtende Metadaten-Dokumentation, zentrale Indizierung sowie Verbesserungen der Repositorien – einschließlich DOI-Vergabe, dateiebene Zugangsmöglichkeiten und Verknüpfung von Skripten – einzuführen, um sicherzustellen, dass Datensätze vollständig, lesbar, fehlerfrei, zugänglich und nicht redundant (CLEAN) sind.
Schlussfolgerung: Um Datenverluste zu verhindern und die Reproduzierbarkeit zu verbessern, sind strukturelle Veränderungen in Repositorien sowie strengere Richtlinien von Fachzeitschriften dringend erforderlich, ergänzt durch rückwirkende Maßnahmen zur Wiederherstellung historischer „dunkler“ Datensätze. Unterbleiben sofortige Maßnahmen, wird die schnelle Generierung neuer biologischer Daten weiterhin durch ebenso schnelle Verluste ausgeglichen, wodurch bestehende Wissenslücken fortbestehen.
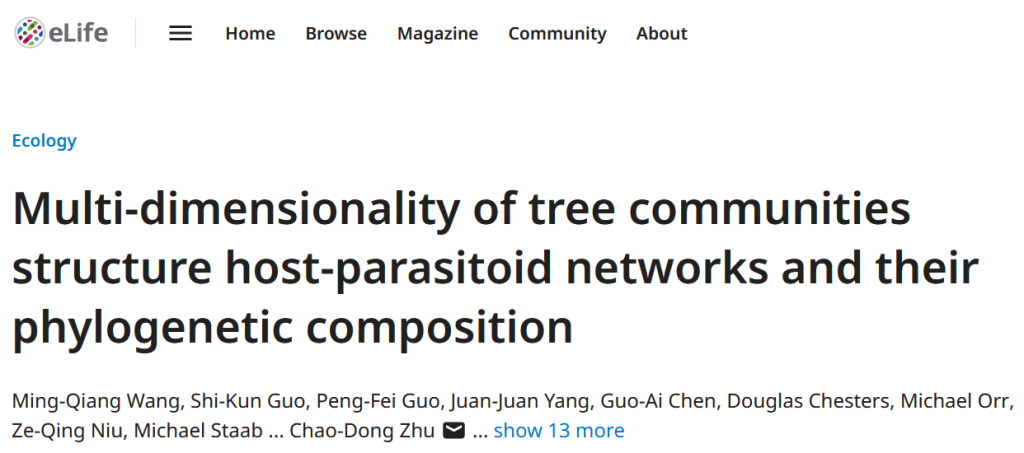
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Ming-Qiang Wang, Douglas Chesters, Michael Orr, Michael Staab, Jing-Ting Chen, Qing-Song Zhu, Felix Fornoff, Xiaoyu Shi, Shan Li, Massimo Martini, Alexandra-Maria Klein, Andreas Schuld, Xiaojuan Liu, Helge Bruelheide, Arong Luo, Chao-Dong Zhu
Zusammenfassung: Diese Studie untersucht, wie unterschiedliche Dimensionen von Baumgemeinschaften die Struktur von Wirt-Parasitoid-Netzwerken und deren phylogenetische Zusammensetzung beeinflussen. Anhand eines fünfjährigen Datensatzes aus einem groß angelegten Biodiversitätsexperiment in einem subtropischen Wald stellten die Autorinnen und Autoren fest, dass verschiedene Komponenten der Baumdiversität – darunter Artenreichtum, phylogenetische Diversität sowie Kronendichte – sowohl die Arten- als auch die phylogenetische Zusammensetzung der Wirts- und Parasitoidengemeinschaften beeinflussen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass phylogenetische Assoziationen zwischen Wirten und Parasitoiden auf nicht zufällig strukturierten Interaktionen beruhen.
Schlussfolgerung: Die Studie legt nahe, dass die Zusammensetzung höherer trophischer Ebenen und ihrer entsprechenden Interaktionsnetzwerke maßgeblich durch die Pflanzenvielfalt und die Kronendichte bestimmt wird, insbesondere über trophische Verbindungen in artenreichen Ökosystemen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass zur Analyse und zum Management von Waldökosystemen mehrere Dimensionen der Biodiversität berücksichtigt werden müssen.
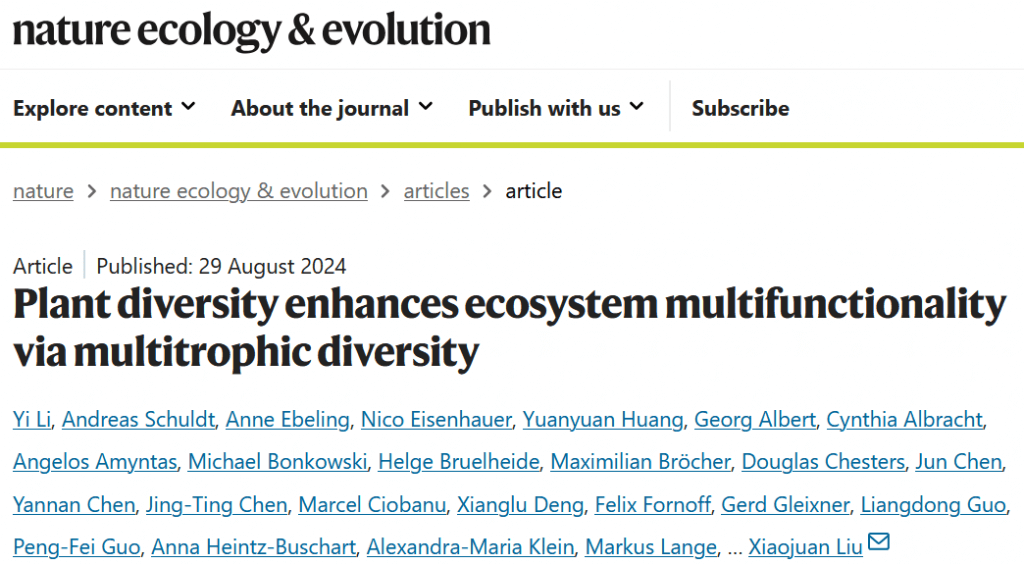
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Yi Li, Andreas Schuldt, Georg Albert, Helge Bruelheide, Douglas Chesters, Jing-Ting Chen, Felix Fornoff, Peng-Fei Guo, Alexandra-Maria Klein, Shan Li, Arong Luo, Thomas Scholten, Michael Staab, Ming-Qiang Wang, Naili Zhang, Chao-Dong Zhu, Xiaojuan Liu
Zusammenfassung: In dieser Studie wurde der Zusammenhang zwischen Pflanzenvielfalt und Ökosystem-Multifunktionalität über indirekte Effekte auf die Vielfalt mehrerer trophischer Ebenen untersucht. Die Analyse basierte auf Daten aus zwei groß angelegten Biodiversitätsexperimenten, einem in einer gemäßigten Graslandschaft (Jena-Experiment) und einem weiteren auf unserer Plattform in BEF-China. Die Ergebnisse zeigten, dass die Pflanzenvielfalt die Multifunktionalität von Ökosystemen fördert, indem sie die Vielfalt mehrerer trophischer Ebenen – etwa von Tieren und Mikroorganismen – erhöht. Zudem wurde festgestellt, dass der Zusammenhang zwischen multitrophischer Vielfalt und Multifunktionalität stärker ausgeprägt ist als der zwischen der Vielfalt einzelner trophischer Gruppen und der Multifunktionalität.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für die Förderung einer langfristig stabilen Ökosystem-Multifunktionalität die Diversität von Pflanzen und höheren trophischen Ebenen in der Naturschutzplanung berücksichtigt werden sollte. Die Studie unterstreicht die Bedeutung eines multitrophischen und multifunktionalen Ansatzes, um die Mechanismen hinter den Zusammenhängen zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen besser zu verstehen.
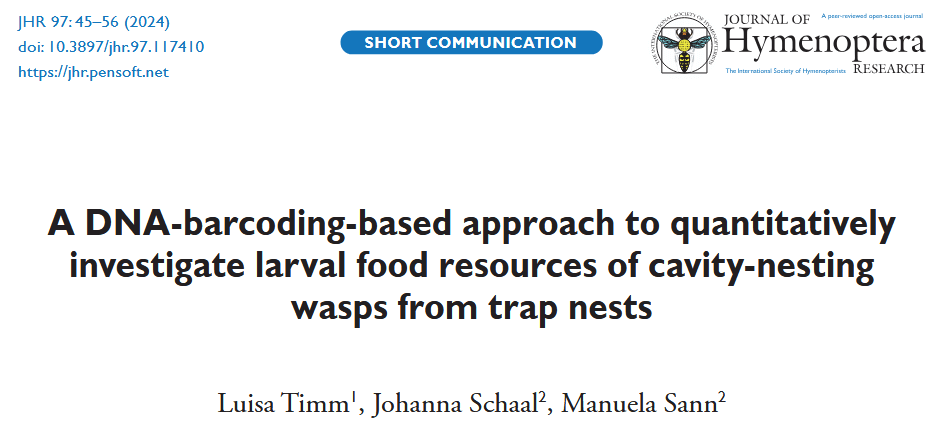
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Manuela Sann
Zusammenfassung: In dieser Studie wurde ein minimal-invasiver Ansatz verwendet, der Schichtnestfallen mit DNA-Barcoding kombinierte, um die Larvennahrungsressourcen und natürlichen Feinde von hohlraumnistenden Wespen quantitativ zu untersuchen. Die Forschenden rekonstruierten multitrophische Interaktionsnetzwerke für sieben Wespenarten, identifizierten bisher unbekannte Nahrungsbeziehungen sowie mehrere Beutetiere, die als land- und forstwirtschaftliche Schädlinge bekannt sind. Die Methode ermöglicht eine quantitative Erfassung der Beutetiere und bietet so ein vertieftes Verständnis der Ernährungsökologie und des Potenzials zur Schädlingskontrolle.
Conclusion: Die Kombination von Nestfallen-Monitoring und DNA-Barcoding ist ein effektives Werkzeug, um die Biologie hohlraumnistender Hymenopteren und ihrer Interaktionspartner umfassend zu untersuchen. Dieser Ansatz bietet praktische Anwendungsmöglichkeiten sowohl für den Artenschutz als auch für die Schädlingsbekämpfung, da er wertvolle Einblicke in komplexe ökologische Netzwerke liefert.
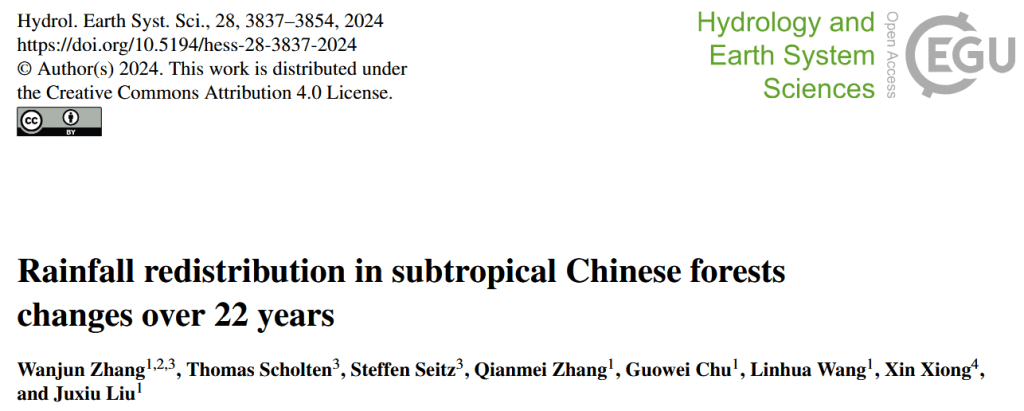
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Thomas Scholten, Steffen Seitz
Zusammenfassung: Die Studie untersuchte, wie Regenfälle durch das Kronendach subtropischer Wälder in China umverteilt werden und wie sich dieser Prozess über 22 Jahre (2001–2022) verändert hat. Basierend auf der Analyse von 740 Regenereignissen zeigte die Forschung, dass sowohl das Durchfallverhältnis (Regen, der durch das Kronendach fällt) als auch das Stammflussverhältnis (Regen, der am Stamm herunterläuft) bei Kiefernwäldern höher waren als in Misch- oder Laubwäldern. Im Zeitverlauf wiesen Durchfall und Stammfluss in den Laubwäldern eine größere Variabilität auf als in den beiden anderen Waldtypen. Zudem wurden signifikante Unterschiede in der Regenwassermenge und -chemie zwischen den drei Waldtypen festgestellt, die sich ebenfalls über die Jahre hinweg veränderten.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Muster der Regenumverteilung über die Zeit verändern und dass diese Veränderungen sowohl von den Eigenschaften der Niederschläge als auch vom Waldtyp abhängen. Die Studie bietet eine langfristige Perspektive auf die Prozesse der Regenumverteilung, indem sie Veränderungen in den Niederschlagsmustern mit den Stadien der Sukzession subtropischer Wälder verknüpft.
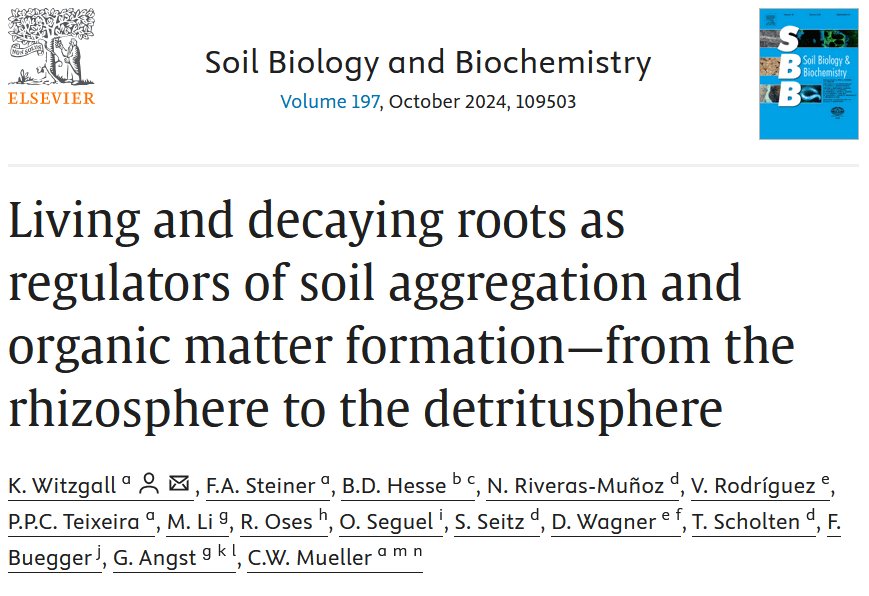
Mitwirkendes Mitglied von MultiTroph: Thomas Scholten
Zusammenfassung: In dieser Studie wurde die Rolle lebender und zerfallender Wurzeln bei der Regulierung der Bodenaggregation und der Bildung organischer Substanz in Trockenökosystemen untersucht – inspiriert durch und anwendbar auf unser BEF-China-Experiment. Mithilfe eines zweiphasigen Inkubationsansatzes verfolgten die Forschenden den Übergang von einem lebenden Pionierpflanzen-Wurzelsystem zu dessen Zersetzung im semi-ariden Ober- und Unterboden. Die Ergebnisse zeigten, dass Wurzeln für die Makroaggregation in der Rhizosphäre beider Bodentypen entscheidend sind und im Unterboden mit einem starken Anstieg der Pilzpopulation einhergehen. Im Oberboden blieb die durch Wurzeln induzierte Makroaggregation sogar nach dem Absterben der Pflanze bestehen, ein Phänomen, das im Unterboden nicht beobachtet wurde.
Schlussfolgerung: Die Forschung unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Studien, die die gesamte zeitliche Dimension von lebenden bis zu sterbenden Pflanzen in intakten Bodensystemen untersuchen, um ein ganzheitliches Verständnis der Wechselwirkungen zwischen Pflanzen, Mikroben und Boden zu gewinnen. Die Ergebnisse heben die bedeutende Rolle der Wurzeln als Regulatoren der Bodenaggregation und der Bildung organischer Substanz hervor.

Mitwirkendes Mitglied von MultiTroph: Georg Albert
Zusammenfassung: In diesem Artikel wird ein mechanistisches Rahmenkonzept vorgeschlagen, das physikalische Faktoren wie Temperatur, Lichtintensität und Viskosität in die Untersuchung von Räuber-Beute-Interaktionen integriert. Dazu wird das Paradigma der Bewegungsökologie mit einer modularen Prädationssequenz kombiniert. Dieser Ansatz zielt darauf ab, zu erklären und vorherzusagen, wie das Zusammenspiel von Organismuseigenschaften und abiotischen Umweltvariablen trophische Interaktionen steuert und daraufhin die Reaktionen von Nahrungsnetzen auf Umweltveränderungen, einschließlich anthropogener Einflüsse wie Klimawandel und Arteninvasionen, beeinflusst.
Schlussfolgerung: Das mechanistische Rahmenkonzept verknüpft die physikalischen Umweltfaktoren mit den Bewegungskomponenten von Organismen und ermöglicht so quantitative Vorhersagen von Räuber-Beute-Interaktionen und Nahrungsnetz-Dynamiken unter sich verändernden physikalischen Bedingungen. Dieser integrative Ansatz unterstützt die Prognose von Ökosystemreaktionen auf anthropogene Stressoren, indem Umweltveränderungen mit der Stärke ökologischer Interaktionen und der Struktur von Nahrungsnetzen verknüpft werden.

Mitwirkendes Mitglied von MultiTroph: Michael Staab
Zusammenfassung: Ökologische Netzwerke von Arteninteraktionen sind weit verbreitet und bieten leistungsstarke Analyseinstrumente für das Verständnis von Variationen in der Struktur von Gemeinschaften und der Funktionsweise von Ökosystemen. Allerdings haben Netzwerkanalysen und häufig verwendete Metriken wie Verschachtelung (nestedness) und Verbindung (connectance) auch Kritik auf sich gezogen. Eine große Sorge besteht darin, dass beobachtete Muster als Nischeneigenschaften wie Spezialisierung fehlinterpretiert werden, während sie stattdessen lediglich Variationen in der Probenahme, Abundanz und/oder Vielfalt widerspiegeln können. Infolgedessen ziehen Studien möglicherweise falsche Schlüsse über ökologische Funktionen, Stabilität oder Koextinktionsrisiken. In diesem Artikel werden potenzielle Verzerrungen bei der Analyse und Interpretation von Arten-Interaktionsnetzwerken hervorgehoben und die verfügbaren Lösungen zu deren Überwindung vorgestellt.
Schlussfolgerung: Die Autoren empfehlen die Verwendung von Nullmodellen in der Netzwerkanalyse, die die Häufigkeit der Arten berücksichtigen. Sie zeigen, warum die Berücksichtigung von Variationen zwischen Arten und Netzwerken für das Verständnis von Arteninteraktionen und deren Folgen wichtig ist. Netzwerkanalysen können das Wissen über die Prinzipien von Arteninteraktionen verbessern, aber nur, wenn sie mit Bedacht eingesetzt werden.
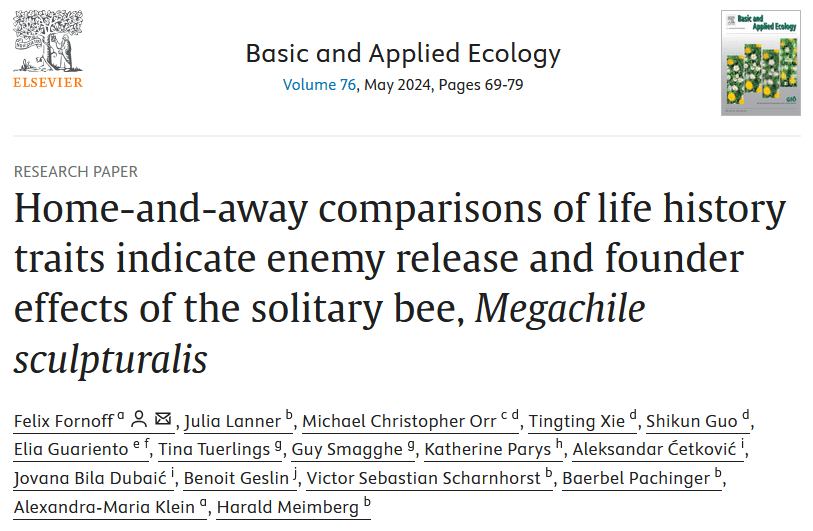
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Felix Fornoff, Michael Christopher Orr, Ting-Ting Xie, Alexandra-Maria Klein
Zusammenfassung: Fornoff und Mitarbeitende führten einen „Home-and-Away“-Vergleich der Life-History-Merkmale der Asiatischen Mörtelbiene, Megachile sculpturalis, einer invasiven Art in Europa und Nordamerika, durch. Die Autorinnen und Autoren werteten Daten zu Nestarchitektur, Nachkommen, natürlichen Feinden, Körpergröße und Phänologie aus dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet in Asien sowie aus anderen Verbreitungsgebieten aus. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Phänologie der Bienen in den exotischen Gebieten im Vergleich zum Ursprungsgebiet auf einen früheren Zeitraum verschob. Während die Gesamtzahl der natürlichen Feinde ähnlich blieb, fehlten in den exotischen Regionen die spezialisierten Feinde. Zudem wiesen die Körpergrößen in den heimischen und exotischen Gebieten keine signifikanten Unterschiede auf, und die Zahl der Brutzellen pro Nesthohlraum war in Europa deutlich höher als in China.
Schlussfolgerung: Der Vergleich der Lebensmerkmale zwischen dem ursprünglichen und den exotischen Verbreitungsgebieten von M. sculpturalis deutet darauf hin, dass Veränderungen in den Merkmalen durch Gründereffekte oder ökologisches Filtern erklärt werden können. Das Fehlen spezialisierter Feinde in den exotischen Gebieten stützt die „Enemy-Release“-Hypothese, die möglicherweise zum reproduktiven Erfolg und zur schnellen Ausbreitung der Art beiträgt.
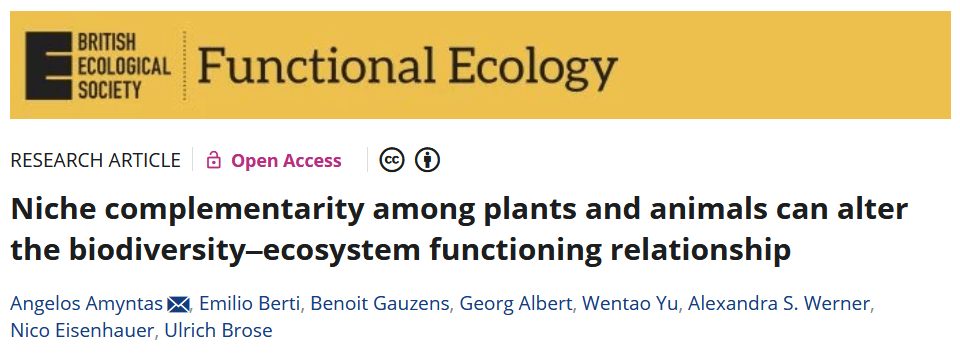
Mitwirkendes Mitglied von MultiTroph: Georg Albert
Zusammenfassung: In dieser Studie wurde ein bioenergetisches Modell verwendet, um zu untersuchen, wie Nischenkomplementarität zwischen Pflanzen und Tieren die Beziehung zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen beeinflusst. Die Forschenden fanden heraus, dass eine erhöhte Nischenkomplementarität bei Pflanzen die Beziehung zwischen Diversität und Funktion stärkt, allerdings nur, wenn sie nicht zu einer Zunahme der intraspezifischen Konkurrenz führt. Zudem zeigte sich, dass eine erhöhte Komplementarität zwischen Tieren zwar positive Effekte haben kann, deren Ausprägung jedoch stark variabel ist. Die Studie hebt die Bedeutung des Zusammenspiels von Merkmalsvariationen innerhalb und zwischen Arten sowie das Gleichgewicht zwischen intra- und interspezifischer Konkurrenz für die langfristige Gestaltung von Ökosystemen hervor.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Art und Weise, wie Nischenkomplementarität zunimmt, entscheidend für die Beziehung zwischen Biodiversität und Ökosystemfunktionen ist. Die Studie liefert neue Einblicke in die zugrunde liegenden Mechanismen dieser Beziehung und hat praktische Implikationen für das Ökosystemmanagement sowie für Naturschutzmaßnahmen.
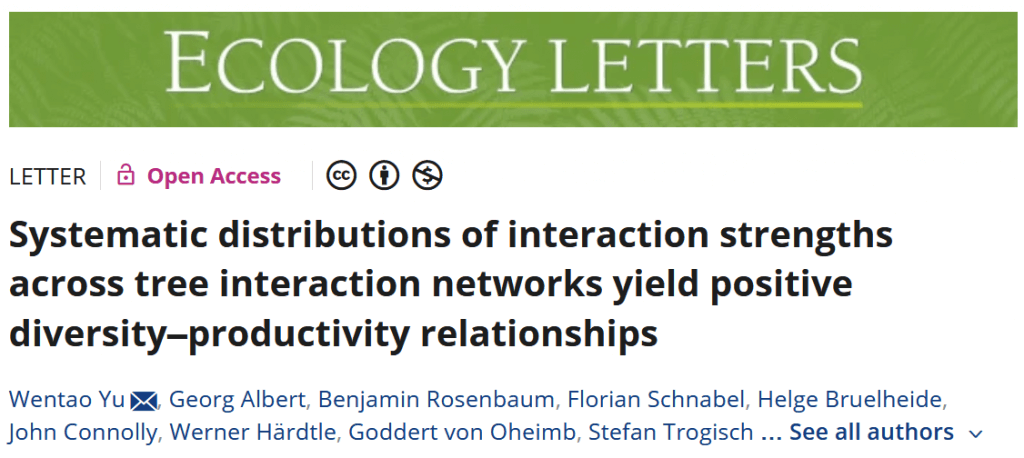
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Georg Albert, Helge Bruelheide
Zusammenfassung: In dieser Studie wurden die Mechanismen der positiven Beziehung zwischen Baumdiversität und Produktivität (DPRs) untersucht, indem Daten aus einem groß angelegten Biodiversitätsexperiment in subtropischen Wäldern Chinas analysiert wurden. Die Forschung zeigte, dass Veränderungen in der Produktivität einzelner Bäume durch artspezifische paarweise Interaktionen bestimmt werden. Es wurde festgestellt, dass ein positiver Unterschied zwischen inter- und intraspezifischen Interaktionen ein entscheidender Faktor für das Entstehen positiver DPRs ist. Überraschenderweise zeigte die Studie zudem, dass die Bedingung für positive DPRs mit der Bedingung für das Koexistieren von Arten übereinstimmt.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse liefern neue Einblicke, wie paarweise Bauminteraktionen die DPRs steuern, und haben Implikationen für die Identifizierung optimaler Baumartenmischungen zur Unterstützung von Waldrestaurierungs- und Aufforstungsmaßnahmen. Die Befunde zeigen, dass die Identität benachbarter Bäume ein entscheidender Faktor für die Produktivität einzelner Bäume ist.

Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Chao-Dong Zhu, Douglas Chesters, Alexandra-Maria Klein, Arong Luo, Michael Orr
Zusammenfassung: Dieses Artikel beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Bienenforschung und -schutzmaßnahmen in Asien. Die Autorinnen und Autoren, ein kollaboratives Team aus 13 asiatischen Ländern und weiteren Regionen, argumentieren, dass Strategien, die in Nordamerika oder Europa entwickelt wurden, aufgrund der einzigartigen Kulturen, Landschaften und Faunen Asiens nicht ohne Weiteres übertragbar sind. Sie heben hervor, dass Asien 15 % der weltweiten Bienenvielfalt beherbergt, diese jedoch nur 1 % der globalen öffentlichen Bienen-Sammeldaten ausmacht, und dass nur sehr wenige Arten nach den Kriterien der IUCN bewertet wurden. Der Artikel beschreibt die besonderen Rahmenbedingungen der Bienenforschung in Asien, die Bedeutung sozialer Bienen als Flagship-Arten für weniger bekannte solitäre Bienen und den dringenden Forschungsbedarf im Hinblick auf die Ernährungssicherung.
Schlussfolgerung: Die Forschenden stellen einen Rahmen für zukünftige Forschung in der Region vor, insbesondere durch staatliche und andere Partnerschaften, um Bienenarten effektiv zu schützen. Sie betonen die Notwendigkeit, das regionale Wissen schnell zu erweitern und den Naturschutz gezielt an die spezifischen Herausforderungen Asiens anzupassen.

Mitwirkendes Mitglied von MultiTroph: Georg Albert
Zusammenfassung: Die Produktivität von Pflanzengemeinschaften nimmt in der Regel mit der Biodiversität zu. Diese positive Beziehung beruht auf Interaktionen zwischen einzelnen Pflanzen. Solche Wechselwirkungen werden häufig auf Ressourcenkonkurrenz zurückgeführt, können jedoch ebenso durch Tiere vermittelt werden. Während ressourcenbasierte Pflanzeninteraktionen räumlich lokal begrenzt sind, variiert die räumliche Ausdehnung tiervermittelter Interaktionen je nach beteiligten Tierarten. Um die Konsequenzen dieser Unterschiede für die Beziehung zwischen Pflanzendiversität und Produktivität zu verstehen, simulierten die Forschenden Pflanzengemeinschaften unter verschiedenen Raumnutzungs-Szenarien und entlang eines Diversitätsgradienten. Sie zeigen, dass die Raumnutzung von Pflanzen und Tieren die Konkurrenz innerhalb von Pflanzengemeinschaften drastisch verändern kann. Insbesondere kann starke, durch Pflanzenfresser vermittelte Konkurrenz zu negativen Diversität-Produktivitäts-Beziehungen führen. Die Raumnutzung größerer Spitzenprädatoren integriert jedoch Sub-Nahrungsnetze kleinerer Arten und kompensiert so potenzielle negative Effekte der Konkurrenz durch Pflanzenfresser und Ressourcen auf die Pflanzengemeinschaften.
Schlussfolgerung: Unterschiede in der Raumnutzung von Tieren verändern die Konkurrenzbeziehungen innerhalb ganzer Nahrungsnetze und führen zu erheblichen Unterschieden darin, wie Pflanzengemeinschaften auf Veränderungen der Pflanzendiversität reagieren. Das Verständnis, wie sich die räumliche Ausprägung von Fressinteraktionen zwischen Tiergemeinschaften unterscheidet, hilft, die treibenden Faktoren von Biodiversitätseffekten zu identifizieren, und kann als Rahmen dienen, um lokale und landschaftliche Prozesse miteinander zu verknüpfen.

Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Felix Fornoff, Alexandra-Maria Klein, Manuela Sann
Zusammenfassung: In dieser Studie wurde DNA-Barcoding verwendet, um quantitative dreistufige und vierstufige Interaktionsnetzwerke von hohlraumnsitenden Wespen, ihren Beutetieren und natürlichen Feinden zu rekonstruieren. Die Forschung identifizierte zuvor unbekannte Räuber-Beute-Interaktionen, darunter auch Beutetiere, die als landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Schädlinge bekannt sind. Die Autorinnen und Autoren zeigten, dass Fangnester in Kombination mit DNA-Barcoding ein wertvolles Werkzeug sind, um diese multitrophischen Interaktionen zu überwachen und bislang unbekannte Fressbeziehungen aufzudecken.
Schlussfolgerung: In dieser Studie wurde DNA-Barcoding eingesetzt, um quantitative dreistufige und vierstufige Interaktionsnetzwerke von hohlraumnistenden Wespen, ihren Beutetieren und natürlichen Feinden zu rekonstruieren. Dabei konnten zuvor unbekannte Räuber-Beute-Beziehungen identifiziert werden, darunter Beutetiere, die als landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Schädlinge bekannt sind. Die Autorinnen und Autoren zeigen, dass Trap-Nester in Kombination mit DNA-Barcoding ein wertvolles Werkzeug darstellen, um diese multitrophischen Interaktionen zu überwachen und bislang unbekannte Fressbeziehungen aufzudecken.

Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Michael Staab, Yi Li, Naili Zhang, Keping Ma, Xiaojuan Liu
Zusammenfassung: Extraflorale Nektarien (EFNs) sind Nektardrüsen außerhalb der Pflanzenblüten. Indem sie einen Schluck der süßen Flüssigkeit anbieten, locken Pflanzen mit EFNs Ameisen und andere natürliche Feinde an, die die Belastung durch Pflanzenfresser verringern können. Solche „Nahrung-gegen-Schutz“-Gegenseitigkeitsbeziehungen sind für Pflanzen mit EFNs ausgiebig untersucht worden. Es war jedoch nicht bekannt, ob diese wechselseitige Beziehung auch benachbarten Pflanzen zugute kommt, die keinen extrafloralen Nektar produzieren. Wir zeigen nun, dass Bäume, die an EFN-Bäume grenzen, mehr Ameisen und weniger Pflanzenfresser haben, verglichen mit gleichartigen Kontrollbäumen ohne EFN-tragende Nachbarn. Gleichzeitig mit den Veränderungen in der Arthropodengemeinschaft veränderte sich die Zusammensetzung von Blatteigenschaften, die möglicherweise mit der Pflanzenabwehr zusammenhängen. Diese neuen Ergebnisse deuten darauf hin, dass, wenn Bäume ohne EFNs von einer geringeren Belastung durch Herbivoren profitieren, weil räuberische Ameisen von EFN-tragenden Nachbarn überlaufen, die Ressourcenallokation für die Verteidigung gesenkt werden könnte, was Ressourcen für das Wachstum freisetzen würde.
Schlussfolgerung: Da Pflanzen mit EFNs in der tropischen und subtropischen Flora häufig vorkommen, könnten die aufgedeckten Mechanismen weit verbreitet und funktionell wichtig sein. So könnte beispielsweise die Aufnahme von EFN-Arten in Artenpools bei Aufforstungs- und Wiederherstellungsprojekten die Kontrolle von Pflanzenfressern, das Wachstum und andere Ökosystemfunktionen fördern.
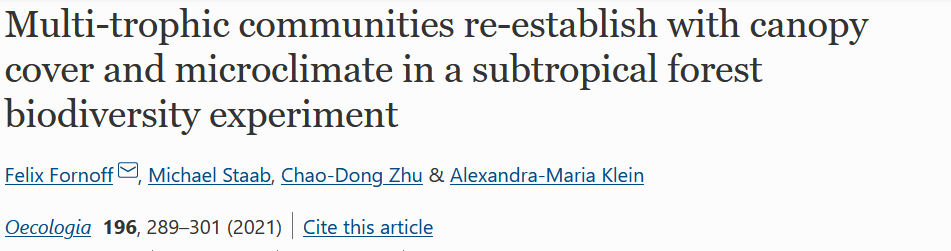
Mitwirkende Mitglieder von MultiTroph: Felix Fornoff, Michael Staab, Chao-Dong Zhu, Alexandra-Maria Klein
Zusammenfassung: Die Pflanzenvielfalt wirkt sich auf multitrophische Gemeinschaften aus, aber in jungen Wäldern, in denen sich Waldinsekten gerade erst wieder ansiedeln, sind andere Faktoren möglicherweise wichtiger. Im BEF-China-Experiment haben wir gezeigt, dass Baumvielfalt keine Rolle spielte. Allerdings waren Baumbiomasse und Überschirmungsgrad, vermittelt durch Veränderungen der mikroklimatischen Bedingungen, wichtig für die Wiederherstellung der Gemeinschaft von Bienen, Wespen und ihrer natürlichen Feinde.
Schlussfolgerung: Obwohl die Maximierung der Baumvielfalt ein wichtiges Ziel der Wiederaufforstung und des Naturschutzes ist, ist die schnelle Schließung der Baumkronen ein wichtiger Faktor für die Wiederherstellung von Gemeinschaften von Waldbienen, Wespen und ihren natürlichen Feinden.